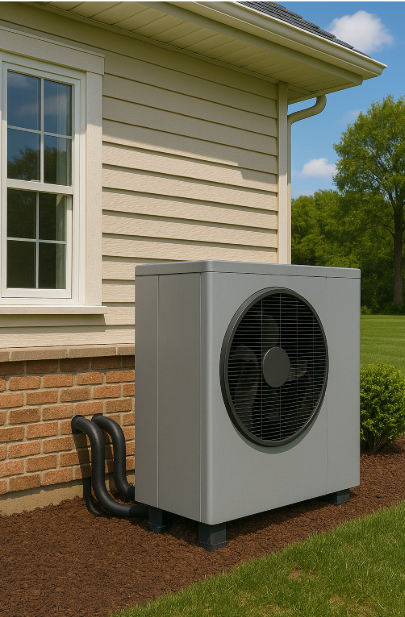Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe kann Ihnen im Vergleich zu einer Ölheizung etwa 40’000 Franken Ersparnis über einen Zeitraum von 20 Jahren bringen. Diese beeindruckende Effizienz zeigt sich auch in der Jahresarbeitszahl von 4, was bedeutet, dass mit nur 1 kWh elektrischer Energie etwa 4 kWh thermische Energie erzeugt werden.
Die Installation einer Wärmepumpe mit Erdsonde nutzt dabei die konstante Temperatur des Erdreichs, die in 100 Metern Tiefe etwa 10 °C beträgt. Während die Gesamtkosten für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bis zu 48’000 Franken betragen können, unterstützen staatliche Förderungen bis zu 50 % der Investitionskosten. In diesem ausführlichen Praxis-Guide erfahren Sie alles Wichtige zur Auswahl der richtigen Sole-Wasser-Wärmepumpe – von der Funktionsweise bis hin zur optimalen Dimensionierung für Ihr Zuhause.
Grundlagen der Sole-Wasser-Wärmepumpe: Funktionsweise verstehen
Die Nutzung der Wärme aus dem Erdinneren bildet die Grundlage für die Funktionsweise einer Sole-Wasser-Wärmepumpe. Während herkömmliche Heizsysteme fossile Brennstoffe verbrennen, nutzt diese Technologie eine nahezu unerschöpfliche und kostenfreie Energiequelle. Aber wie funktioniert dieses System genau? Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf die Grundprinzipien werfen.
Wie die Erdwärme als Energiequelle genutzt wird
Das Erdreich ist ein gewaltiger Wärmespeicher. Ab einer Tiefe von etwa zehn Metern bleibt die Temperatur des Bodens das ganze Jahr über konstant bei ungefähr 8-10°C. Diese Beständigkeit macht die Erdwärme zu einer verlässlichen Energiequelle – selbst wenn die oberste Erdschicht im Winter gefroren ist.
Um die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie zu nutzen, kommen hauptsächlich drei verschiedene Methoden zum Einsatz:
- Erdsonden: Diese werden vertikal oder leicht schräg durch Bohrungen in Tiefen von 40 bis 100 Metern in die Erde eingelassen. Sie arbeiten besonders effizient, da die Temperatur in grösserer Tiefe konstant bleibt.
- Erdkollektoren: Diese werden horizontal in einer Tiefe von 0,8 bis 1,5 Metern verlegt. Sie benötigen mehr Fläche als Erdsonden und werden schlangenförmig im Abstand von 60 bis 80 Zentimetern angeordnet.
- Erdwärmekörbe: Diese stellen einen Kompromiss dar und werden in 3 bis 5 Meter Tiefe vergraben. Sie benötigen weniger Platz als Flächenkollektoren, erreichen jedoch nicht die Effizienz von Tiefensonden.
Die Wahl des Systems hängt hauptsächlich von der verfügbaren Grundstücksfläche, der Bodenbeschaffenheit und den geologischen Gegebenheiten ab.
Der Kreislauf: Von der Sole zum Heizsystem
Der eigentliche Wärmepumpenprozess besteht aus drei miteinander verbundenen Kreisläufen:
1. Solekreislauf (Primärkreislauf): In den Erdsonden oder Erdkollektoren zirkuliert eine frostsichere Flüssigkeit, die sogenannte Sole[41]. Diese Flüssigkeit nimmt die Wärme aus dem Erdreich auf und transportiert sie zur Wärmepumpe.
2. Kältemittelkreislauf (in der Wärmepumpe): Der Kreislauf in der Wärmepumpe selbst lässt sich in vier Schritte unterteilen:
- Verdampfung: Im Verdampfer gibt die Sole ihre Wärme an das Kältemittel ab. Dieses hat einen sehr niedrigen Siedepunkt und verdampft bereits bei geringen Temperaturen.
- Verdichtung: Der gasförmige Kältemitteldampf wird durch einen elektrisch betriebenen Verdichter (Kompressor) komprimiert. Dabei steigen sowohl der Druck als auch die Temperatur des Gases erheblich an.
- Verflüssigung: Im Verflüssiger (Kondensator) gibt das nun heisse Gas seine Wärme an das Heizungswasser ab und wird dabei wieder flüssig.
- Entspannung: Das flüssige Kältemittel durchläuft ein Expansionsventil, das den Druck reduziert. Dadurch sinkt die Temperatur des Kältemittels wieder, und der Kreislauf kann von Neuem beginnen.
3. Heizkreislauf (Sekundärkreislauf): Das erwärmte Heizungswasser zirkuliert durch das Heizsystem des Gebäudes (Fussbodenheizung oder Heizkörper) und gibt die Wärme an die Räume ab.
Für diesen gesamten Prozess benötigt die Wärmepumpe elektrische Energie für den Antrieb des Verdichters. Das Verhältnis zwischen erzeugter Nutzwärme und eingesetzter elektrischer Energie wird als Leistungszahl (COP) bezeichnet. Je niedriger die Temperaturdifferenz zwischen der Wärmequelle und der benötigten Vorlauftemperatur des Heizsystems ist, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
Unterschied zu anderen Wärmepumpentypen
Sole-Wasser-Wärmepumpen unterscheiden sich in mehreren wesentlichen Punkten von anderen Wärmepumpentypen:
- Im Vergleich zu Luft-Wasser-Wärmepumpen: Diese nutzen die Aussenluft als Wärmequelle, deren Temperatur stark schwankt. Besonders bei sehr niedrigen Aussentemperaturen sinkt die Effizienz erheblich. Sole-Wasser-Wärmepumpen erreichen hingegen eine durchschnittliche Jahresarbeitszahl (JAZ) von 4,1, während Luft-Wasser-Wärmepumpen nur auf etwa 3,1 kommen. Bei einem Wärmebedarf von 17.000 Kilowattstunden pro Jahr kann dies eine Stromkostenersparnis von rund 420 Euro bedeuten.
- Im Vergleich zu Wasser-Wasser-Wärmepumpen: Diese nutzen direkt das Grundwasser als Wärmequelle und arbeiten mit einem offenen Kreislauf. Sie sind theoretisch noch effizienter als Sole-Wasser-Wärmepumpen, benötigen jedoch geeignete Grundwasservorkommen und erfordern ein aufwändiges Bewilligungsverfahren. Zudem müssen zwei Brunnen (Saug- und Sickerbrunnen) mit einem Mindestabstand von 15 Metern angelegt werden.
Bei der Entscheidung für eine bestimmte Wärmepumpenart spielen folglich nicht nur Effizienzfaktoren, sondern auch die lokalen Gegebenheiten, Platzverhältnisse und rechtlichen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle.
Verschiedene Arten von Erdwärmequellen im Vergleich
Die Wahl der richtigen Erdwärmequelle für Ihre Sole-Wasser-Wärmepumpe entscheidet massgeblich über Effizienz und Wirtschaftlichkeit Ihres Heizsystems. Jede Variante hat ihre spezifischen Vorzüge und eignet sich für unterschiedliche Grundstückssituationen. Im Folgenden stelle ich die drei gängigsten Methoden mit ihren jeweiligen Besonderheiten vor.
Erdsonden: Tiefenbohrung für maximale Effizienz
Erdsonden nutzen die konstante Temperatur in tieferen Erdschichten und bieten dadurch eine besonders zuverlässige Wärmequelle. Ab einer Tiefe von etwa 15 Metern beträgt die Temperatur des Erdreichs konstant circa zehn Grad Celsius und nimmt mit zunehmender Tiefe weiter zu. In der Praxis werden Erdsonden meist in Tiefen zwischen 40 und 100 Metern installiert.
Der Installationsprozess beginnt mit einer oder mehreren Bohrungen, in die anschliessend Doppel-U-Rohre eingelassen werden. Diese werden mit einem speziellen Betongemisch versiegelt. In den Rohren zirkuliert die Sole – ein umweltfreundliches Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel – die dem Erdreich Wärme entzieht.
Die Entzugsleistung einer Erdsonde liegt je nach Bodenbeschaffenheit zwischen 30 und 100 Watt pro Meter. Bei trockenen Böden fällt die Leistung niedriger aus als bei feuchten, grundwasserführenden Böden.
Ein entscheidender Vorteil der Erdsonden liegt in ihrem geringen Platzbedarf. Im Vergleich zu anderen Erdwärmequellen benötigen sie minimal Grundstücksfläche. Deshalb sind sie besonders für kleinere Grundstücke geeignet. Allerdings müssen hierbei einige Voraussetzungen erfüllt sein:
- Eine Zufahrtsmöglichkeit und ausreichend Platz für das Bohrgerät
- Bei kleinen Grundstücken können kompakte Bohrgeräte eingesetzt werden
- Die Bohrung muss von der zuständigen Wasserbehörde genehmigt werden
Zusätzlich bieten Erdsonden den Vorteil eines ganzjährig konstanten und hohen Wirkungsgrads sowie die Möglichkeit, das System im Sommer zur passiven Kühlung zu nutzen.
Flächenkollektoren: Die platzbeanspruchende Alternative
Flächenkollektoren werden horizontal und oberflächennah in einer Tiefe von etwa 1 bis 1,5 Metern im Erdreich verlegt. Diese Verlegungstiefe ist wichtig, um einerseits Frostschutz zu gewährleisten und andererseits die thermische Energie von Sonneneinstrahlung und Regenwasser nutzen zu können.
Das Rohrsystem wird meist mäanderförmig, als Schnecke oder nach dem Tichelmann-Prinzip installiert. Der Abstand zwischen den Rohren sollte dabei 70 bis 80 Zentimeter betragen, um eine Vereisung des Bodens zu vermeiden.
Der Hauptnachteil dieser Methode liegt im erheblichen Flächenbedarf. Als Faustregel gilt: Die benötigte Kollektorfläche sollte etwa das 1,5- bis 2,5-fache der zu beheizenden Wohnfläche betragen. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche entspricht das ungefähr 280 Quadratmetern Kollektorfläche.
Die Entzugsleistung eines Erdreichkollektors variiert je nach Bodenbeschaffenheit erheblich:
- Bei trockenem, sandigem Boden: 10 bis 15 W/m²
- Bei grundwasserführendem Boden: bis zu 40 W/m²
Flächenkollektoren haben jedoch auch Vorteile gegenüber Tiefenbohrungen: Sie sind kostengünstiger in der Installation und benötigen keine behördliche Genehmigung. Die Kosten liegen etwa zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
Erdwärmekörbe: Der Kompromiss für kleinere Grundstücke
Für Grundstücke, die zu klein für Flächenkollektoren, aber ungünstig für Tiefenbohrungen sind, bieten Erdwärmekörbe eine praktische Alternative. Diese kegelförmigen Körbe bestehen aus Kunststoffrohren, die spiral- bzw. korbförmig angeordnet sind.
Erdwärmekörbe werden in einer Tiefe von etwa 2,5 bis 4 Metern installiert. Dadurch benötigen sie deutlich weniger Fläche als horizontale Kollektoren. Pro Korb ist nur ein kompakter Aushub notwendig, statt langer Gräben.
Die Heizleistung eines einzelnen Erdwärmekorbs liegt je nach Modell zwischen 0,5 und 2 kW. Bei einem Mittelwert von 1,25 kW werden für ein durchschnittliches Einfamilienhaus etwa sechs Erdwärmekörbe benötigt, was einer Gesamtfläche von ungefähr 90 m² entspricht.
Besonders vorteilhaft an Erdwärmekörben ist:
- Kurze Einbauzeit von etwa 1-2 Tagen
- Keine Genehmigungspflicht (ausser bei hohem Grundwasserstand)
- Geeignet für alle Bodenarten und sogar für Hanglagen
- Kostengünstiger als Erdsonden und platzsparender als Flächenkollektoren
Allerdings muss beachtet werden, dass die Grundstücksfläche über den Erdwärmekörben weder bebaut noch versiegelt werden darf, da Sonneneinstrahlung und Niederschlag zur Wärmeregeneration des Bodens beitragen.
Bei allen drei Varianten zirkuliert in den Rohrsystemen das Solegemisch, das die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und an die Wärmepumpe weiterleitet. Die Entscheidung für das passende System sollte immer unter Berücksichtigung der individuellen Grundstückssituation, Bodenbeschaffenheit und der energetischen Anforderungen des Gebäudes getroffen werden.
Ihr Grundstück analysieren: Eignung für eine Erdsonden-Wärmepumpe
Bevor Sie sich für eine Erdsonden-Wärmepumpe entscheiden, ist eine gründliche Analyse Ihres Grundstücks unerlässlich. Die geothermischen Bedingungen variieren stark von Ort zu Ort, und nicht jedes Grundstück eignet sich gleichermassen für diese Technologie. Mit einer sorgfältigen Vorabprüfung vermeiden Sie unnötige Kosten und gewährleisten die optimale Leistung Ihrer Anlage.
Bodenbeschaffenheit und geologische Voraussetzungen
Die Effizienz einer Sole-Wasser-Wärmepumpe hängt massgeblich von den geologischen Gegebenheiten ab. Ab einer Tiefe von etwa 12 Metern kann mit konstanten Temperaturen von circa 10°C gerechnet werden, wobei diese je nach Bodensubstrat, geographischer Höhenlage und Wassergehalt variieren. Mit zunehmender Tiefe steigt die Temperatur um etwa 3°C pro 100 Meter an.
Unterschiedliche Bodenarten beeinflussen die Wärmeentzugsleistung erheblich:
- Trockene, sandige Böden bieten geringere Entzugsleistungen
- Feuchte, grundwasserführende Böden liefern höhere Wärmeerträge
Ein wichtiger Faktor ist zudem der zeitliche Verzug zwischen Wärmeentzug und -nachschub. Bei kontinuierlicher Förderung kann die Temperatur im Erdreich stark absinken, weshalb ein zeitweiser Unterbruch des Wärmeentzugs notwendig ist. Dies erfolgt normalerweise automatisch durch die Ein- und Ausschaltzyklen der Heizanlage.
Zur Beurteilung der geologischen Eignung Ihres Standorts sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der ein hydrogeologisches Gutachten erstellt. Ausserdem können Sie die kantonalen Eignungskarten konsultieren, die Aufschluss über die grundsätzliche Eignung Ihres Standorts geben.
Platzbedarf und rechtliche Einschränkungen
Für die Durchführung einer Erdsondenbohrung wird ein ausreichend grosser Arbeitsbereich benötigt. Der Bohrplatz selbst erfordert mindestens 30 m² Fläche. Zusätzlich muss Raum für einen Kompressor (etwa 2,5 x 5 Meter) sowie für zwei Mulden zur Aufnahme des Bohrschlamms eingeplant werden, wobei jede Mulde etwa einen Autoparkplatz benötigt.
Wichtige Abstandsregeln müssen eingehalten werden:
- Mindestabstand zwischen zwei Sonden: 5-6 Meter (um thermische Beeinflussung zu vermeiden)
- Abstand zur Grundstücksgrenze: mindestens 3 Meter pro 100 Meter Bohrtiefe
- Abstand zu Gebäuden: mehrere Meter (je nach kantonalen Vorschriften)
Darüber hinaus gibt es bestimmte Zonen, in denen Erdsondenbohrungen grundsätzlich nicht zulässig sind:
- In Grundwasserschutzzonen (S)
- In Summarischen Schutzzonen (SS)
- In Schutzarealen (SA)
- Im Uferbereich bzw. Gewässerraum
Beachten Sie auch mögliche Hindernisse wie Bäume, Gebäudeteile oder Stromleitungen, die den Bau erschweren könnten. Die Bodenoberfläche muss zudem stabil genug sein, um alle Geräte sicher platzieren zu können.
Wann ist eine Genehmigung erforderlich?
Bohrungen für Erdwärmesonden sind in der Schweiz grundsätzlich bewilligungspflichtig. Die erforderlichen Genehmigungen variieren jedoch je nach Kanton und lokalen Vorschriften.
Generell benötigen Sie:
- Eine gewässerschutzrechtliche Bewilligung vom Amt für Natur und Umwelt oder der entsprechenden kantonalen Behörde
- Eine Baubewilligung der Standortgemeinde (in den meisten Kantonen)
Für die Beantragung müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:
- Ein ausgefülltes Gesuchsformular
- Ein Lageplan mit den geplanten Sondenstandorten
- Angaben zur Zieltiefe und Anlagenkonfiguration
- Gegebenenfalls ein hydrogeologisches Gutachten
Vor der Antragstellung empfiehlt sich eine Vorabklärung mithilfe der kantonalen Erdwärmenutzungskarten. Diese zeigen, ob Bohrungen an Ihrem Standort zulässig sind, und definieren drei Zulässigkeitsbereiche:
- Zulässig (grün) – Standardauflagen bis 200 m Tiefe
- Bedingt zulässig (gelb) – Spezialauflagen und eventuell hydrogeologische Vorabklärung nötig
- Nicht zulässig (rot) – keine Bohrungen möglich
Das Bundesamt für Energie hat mit www.kann-ich-bohren.ch ein Online-Tool geschaffen, mit dem Sie die Chancen für eine Bewilligung schnell und einfach abklären können. Diese Anwendung verknüpft die Schnittstellen der kantonalen Eignungskarten und ist für die meisten Kantone verfügbar.
Im Gegensatz zu Erdsonden benötigen Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Flächenkollektoren oder Erdwärmekörben in der Regel keine Genehmigung, da hier keine Gefahr der Grundwasserverunreinigung besteht. Diese Alternativen sollten daher in Betracht gezogen werden, wenn an Ihrem Standort Bohrungen nicht möglich sind oder der Genehmigungsprozess zu komplex erscheint.
Wärmebedarf berechnen: Die richtige Dimensionierung finden
Die richtige Dimensionierung einer Sole-Wasser-Wärmepumpe ist entscheidend für deren Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass überdimensionierte Anlagen nicht nur unnötig hohe Investitionskosten verursachen, sondern auch zu einem erhöhten Energieverbrauch führen können. In manchen Fällen kann eine Überdimensionierung den Energieverbrauch um bis zu 30% erhöhen und die Lebensdauer der Anlage um 20 bis 40% verkürzen. Im Folgenden erkläre ich, wie Sie den Wärmebedarf Ihres Gebäudes präzise berechnen.
Wohnfläche und Dämmstandard berücksichtigen
Der Wärmebedarf eines Gebäudes hängt massgeblich von der zu beheizenden Fläche und dem Dämmstandard ab. Für eine erste Orientierung kann folgende Faustformel angewendet werden:
Wohnfläche [m²] × spezifischer Wärmebedarf [kW/m²] = Gesamtwärmebedarf [kW]
Der spezifische Wärmebedarf unterscheidet sich dabei deutlich je nach Gebäudetyp:
| Gebäudetyp | Spezifischer Wärmebedarf | Beispiel für 150 m² |
|---|---|---|
| Unsanierter Altbau | 0,12 kW/m² | 18 kW |
| Teilsanierter Altbau | 0,08 kW/m² | 12 kW |
| Neubau (nach EnEV) | 0,04 kW/m² | 6 kW |
| Passivhaus | 0,015 kW/m² | 2,25 kW |
Bei einem teilsanierten Haus mit 150 m² Wohnfläche ergibt sich beispielsweise ein Gesamtwärmebedarf von etwa 12 kW Heizleistung.
Allerdings ist zu beachten, dass diese Überschlagsrechnung eine normgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 nicht ersetzen kann. Diese Norm berücksichtigt zusätzliche Faktoren wie:
- U-Werte der Fenster und Aussenbauteile
- Sonneneinstrahlung und Verschattung
- Lüftungsverluste
- Norm-Aussentemperaturen (regional unterschiedlich, oft -10 bis -14°C)
In der Schweiz wird häufig mit einer Norm-Auslegungstemperatur von -12°C und einer Heizgrenztemperatur von 15°C gerechnet.
Warmwasserbedarf einkalkulieren
Neben dem reinen Heizwärmebedarf muss auch die Energie für die Warmwasserbereitung berücksichtigt werden. Hierfür gilt als Faustregel: 0,25 kW zusätzliche Leistung pro Person im Haushalt.
Bei einer vierköpfigen Familie wären das also zusätzlich 1 kW Leistung, die auf den berechneten Heizwärmebedarf aufgeschlagen werden müssen.
Für eine genauere Berechnung des Warmwasserbedarfs kann auch von konkreten Verbrauchssituationen ausgegangen werden. So benötigt beispielsweise eine standard Badewannenfüllung (180 Liter mit 40°C) etwa 6,28 kWh thermische Energie:
Q = m × c × ΔT
Q = 180 kg × 1,163 Wh/(kg×K) × 30 K = 6280,2 Wh
Dabei steht m für die Wassermenge, c für die spezifische Wärmekapazität und ΔT für die Temperaturdifferenz zwischen Kalt- und Warmwasser (hier: 40°C – 10°C = 30K).
Reserven für extreme Kälteperioden
Die Dimensionierung einer Sole-Wasser-Wärmepumpe sollte Reserven für besonders kalte Tage beinhalten, ohne dabei in eine übermässige Überdimensionierung zu verfallen. Während Luft-Wasser-Wärmepumpen bei tiefen Temperaturen deutlich an Effizienz verlieren, arbeiten Sole-Wasser-Wärmepumpen auch bei extremer Kälte weitgehend konstant.
Dennoch sollten folgende Faktoren bei der Planung berücksichtigt werden:
- EVU-Sperrzeiten: Falls Sie einen günstigen Wärmepumpentarif nutzen möchten, sollten Sie die möglichen Sperrzeiten des Energieversorgers einkalkulieren. Bei einer Sperrzeit von 4 Stunden empfiehlt sich ein Aufschlag von etwa 20% auf die berechnete Heizleistung.
- Pufferspeicherdimensionierung: Der Pufferspeicher sollte so ausgelegt sein, dass die Mindestlaufzeit des Kompressors eingehalten werden kann. Die benötigten Speichervolumina betragen je nach Wärmequelle:
- Luftwärmepumpen: ca. 86 Liter
- Solewärmepumpen: ca. 101,5 Liter
- Wasserwärmepumpen: ca. 97,2 Liter
- Bivalenzpunkt beachten: Der Bivalenzpunkt beschreibt die Temperatur, ab der die Wärmepumpe allein nicht mehr ausreicht und eine Zusatzheizung benötigt wird. Bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe liegt dieser Punkt typischerweise so niedrig, dass ein monovalenter Betrieb möglich ist.
Abschliessend ist zu betonen, dass die Erfahrung zeigt, dass etwa drei Viertel aller Mehrfamilienhäuser Wärmepumpen mit einer Überdimensionierung zwischen 10% und 60% aufweisen. Dies führt zu einem durchschnittlichen Mehrverbrauch an Heizwärme von 44%. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass bei erdgekoppelten Sole-Wasser-Wärmepumpen eine leichte Überdimensionierung die Effizienz sogar steigern kann. Allerdings sollte dies in einem vertretbaren Rahmen bleiben, um unnötige Kosten zu vermeiden.
Kosten und Wirtschaftlichkeit der Sole-Wasser-Wärmepumpe
Bei der Investition in eine Sole-Wasser-Wärmepumpe fallen zunächst höhere Kosten an als bei konventionellen Heizungen. Allerdings machen sich die niedrigen Betriebskosten und die lange Lebensdauer langfristig bezahlt. Die Betrachtung der Gesamtkosten über den Lebenszyklus zeigt daher ein deutlich positiveres Bild.
Anschaffungskosten im Detail: Wärmepumpe, Bohrung, Installation
Die Investitionskosten einer Sole-Wasser-Wärmepumpe setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen. Für die Wärmepumpe selbst müssen Sie mit etwa CHF 20’000 rechnen. In Deutschland liegen die Kosten für das Gerät zwischen 12’000 und 15’000 Euro. Darüber hinaus entstehen folgende Kosten:
- Erschliessung der Wärmequelle: Bei Erdsondenbohrungen fallen pro Bohrmeter 60-100 Euro an, bei Erdkollektoren hingegen nur 20-30 Euro pro Quadratmeter
- Installation und Handwerkerkosten: Etwa CHF 6’000
- Speicher und Zubehör: Ungefähr CHF 6’000
- Wärmemengenzähler: Etwa 1’000 Euro
Die Bohrungskosten machen einen erheblichen Teil der Gesamtinvestition aus und können je nach Standort, Bodenbeschaffenheit und Tiefe bis zu CHF 16’000 betragen. Insgesamt müssen Sie für ein Einfamilienhaus mit Erdsonden mit Gesamtkosten zwischen CHF 39’000 und 48’000 rechnen.
Betriebskosten im Vergleich zu anderen Heizsystemen
Im Vergleich zur Anschaffung sind die Betriebskosten einer Sole-Wasser-Wärmepumpe bemerkenswert niedrig. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus betragen die jährlichen Stromkosten etwa CHF 1’300. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe liegen die Kosten hingegen bei circa CHF 1’600 pro Jahr.
| Heizsystem | Jährliche Betriebskosten |
|---|---|
| Sole-Wasser-Wärmepumpe | CHF 800-1’300[214] |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | CHF 1’000-1’600[222] |
| Ölheizung | <citation index=”4″ link=”https://www.vaillant.ch/privatkunden/ratgeber-heizung/heiztechnologie-verstehen/warmepumpen/kosten-warmepumpe/” similar_text=”• Betriebskosten pro Jahr |
| Gasheizung | <citation index=”4″ link=”https://www.vaillant.ch/privatkunden/ratgeber-heizung/heiztechnologie-verstehen/warmepumpen/kosten-warmepumpe/” similar_text=”• Betriebskosten pro Jahr |
Neben den Energiekosten fallen jährlich etwa CHF 100-150 für Wartungsarbeiten an. Insgesamt ergibt sich dadurch ein bedeutender Kostenvorteil gegenüber konventionellen Systemen.
Amortisationszeit berechnen: Wann lohnt sich die Investition?
Trotz der höheren Anfangsinvestition rentiert sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe durch die niedrigen Betriebskosten bereits nach einigen Jahren. Die Amortisationszeit lässt sich mit folgender Formel berechnen:
Amortisationsdauer = (Investitionssumme - Fördersumme) / (Heizkosten mit alter Heizung - Heizkosten mit Wärmepumpe)
Folgende Faktoren beeinflussen die Amortisationszeit wesentlich:
- Förderungen: In der Schweiz können Sie je nach Kanton und Dimensionierung zwischen CHF 2’000 und 20’000 an Fördergeldern erhalten
- Effizienz der Anlage: Eine höhere Jahresarbeitszahl (JAZ) senkt die Betriebskosten erheblich
- Energiepreise: Die Differenz zwischen Strom- und Öl-/Gaspreisen wirkt sich direkt auf die Wirtschaftlichkeit aus
In einem typischen Szenario beträgt die Amortisationszeit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonden beim Ersatz einer Ölheizung etwa 11 Jahre, wenn staatliche Förderungen genutzt werden. Ohne Förderung erhöht sich dieser Zeitraum auf 15-18 Jahre.
Beachtlich ist ausserdem: Nach etwa 20 Jahren, wenn die Heizung erneuert werden muss, müssen keine neuen Bohrungen mehr vorgenommen werden. Dadurch steigt die Ersparnis im zweiten Lebenszyklus deutlich an. Über einen Zeitraum von 20 Jahren kann die Einsparung im Vergleich zu einer Ölheizung bis zu CHF 40’000 betragen.
Fördermöglichkeiten in der Schweiz optimal nutzen
Die Investition in eine Sole-Wasser-Wärmepumpe wird in der Schweiz durch zahlreiche Förderprogramme unterstützt, wodurch die anfänglich höheren Kosten deutlich reduziert werden können. Diese finanziellen Anreize machen den Umstieg auf umweltfreundliche Heiztechnologien besonders attraktiv.
Kantonale Förderprogramme für Erdwärmepumpen
Das Gebäudeprogramm bildet die Grundlage der kantonalen Förderung und unterstützt schweizweit die Verbesserung der Wärmedämmung sowie den Umstieg auf erneuerbare Energien. Die Förderbeiträge variieren dabei erheblich je nach Kanton:
| Kanton | Mindestförderung für Sole-Wasser-Wärmepumpen |
|---|---|
| Wallis | ab CHF 9’000 |
| Obwalden | ab CHF 4’800 |
| Luzern | ab CHF 8’500 (bis 15 kW) |
| Zürich (Stadt) | ab CHF 8’000 |
| Basel-Landschaft | ab CHF 5’000 |
Besonders lukrativ ist der Ersatz von Öl- und Gaskesseln durch Wärmepumpen, der in manchen Kantonen mit bis zu CHF 9’000 gefördert wird. Die Höhe der Förderung setzt sich typischerweise aus einem Grundbetrag und einem zusätzlichen Betrag pro kW Heizleistung zusammen.
Wichtig: Der Antrag auf Förderung muss zwingend vor Beginn der Arbeiten gestellt werden. Nach Erhalt der Förderzusage haben Sie in der Regel zwei Jahre Zeit, das Projekt abzuschliessen.
Steuerliche Vorteile bei energetischen Sanierungen
Zusätzlich zu direkten Förderbeiträgen profitieren Sie von attraktiven Steuervorteilen. Im Gegensatz zu normalen Renovationsmassnahmen können Investitionen in die Energieeffizienz vollständig von den Steuern abgesetzt werden, selbst wenn sie wertsteigernd sind.
Besonders vorteilhaft: Seit 2020 können Investitionskosten für Energiesparmassnahmen, die nicht vollständig in einem Steuerjahr berücksichtigt werden können, auf bis zu drei Steuerperioden übertragen werden. Dadurch lässt sich die Steuerprogression über mehrere Jahre hinweg senken und die steuerliche Entlastung maximieren.
Die absetzbaren Massnahmen umfassen unter anderem:
- Massnahmen zur Verminderung der Energieverluste der Gebäudehülle
- Massnahmen zur rationellen Energienutzung bei haustechnischen Anlagen
- Kosten für energietechnische Analysen und Energiekonzepte
Während die meisten Kantone das Modell der direkten Bundessteuer vollständig übernommen haben, gibt es einige Unterschiede in der Umsetzung. Die Kantone ZH, SZ, UR, NW, GL, ZG, SG, FR, SO, BS, AI, TG, VD, JU und GE lassen in der Regel Steuerabzüge in der Höhe von 100 Prozent des Investitionswerts zu.
Spezielle Förderprogramme für Altbausanierungen
Neben den kantonalen Förderprogrammen existieren weitere Unterstützungsmöglichkeiten:
Die Klimaprämie von Energie Zukunft Schweiz unterstützt schweizweit den Ersatz fossiler Heizungen durch erneuerbare Alternativen. Sie wird anhand des jährlichen Energieverbrauchs berechnet und beträgt 18 Rappen pro Kilowattstunde bzw. 1,80 Franken pro Liter Erdöl.
Darüber hinaus bietet die gemeinnützige Stiftung myclimate ein Förderprogramm speziell für Wärmepumpen an. Dieses gilt für den Ersatz von Heizöl- oder Erdgasheizungen in vermieteten Wohnobjekten und kann teilweise höhere Förderbeiträge bieten als die kantonalen Programme.
Zudem fördern viele Banken energetische Sanierungen durch vergünstigte Hypothekarzinsen. Beispielsweise unterstützt die TKB nachhaltige Renovationen mit einer Hypothekarzinsreduktion von 0,50 Prozent.
Für eine massgeschneiderte Übersicht aller verfügbaren Fördermöglichkeiten empfiehlt sich die Nutzung von Online-Portalen wie:
- www.energiefranken.ch (Eingabe der Postleitzahl des Gebäudestandorts)
- www.baufoerdergelder.ch (über 1200 Schweizer Förderprogramme)
Beachten Sie unbedingt: Eine Kombination aus kantonaler Förderung, Klimaprämie und myclimate-Förderung ist nicht möglich. Daher sollten Sie sorgfältig prüfen, welches Programm für Ihre spezifische Situation die höchste Förderung bietet.
Qualitätskriterien für die Auswahl des richtigen Modells
Nach der finanziellen Betrachtung rücken nun die technischen Qualitätskriterien in den Fokus, die für eine langfristig zufriedenstellende Sole-Wasser-Wärmepumpe entscheidend sind. Das richtige Modell zu wählen bedeutet, verschiedene Kennzahlen und Eigenschaften zu verstehen und miteinander zu vergleichen.
Jahresarbeitszahl (JAZ) und COP-Wert verstehen
Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch zwei zentrale Kennzahlen beschrieben: den COP-Wert und die Jahresarbeitszahl (JAZ).
Der COP (Coefficient of Performance) gibt das Verhältnis zwischen erzeugter Wärmeenergie und eingesetzter elektrischer Energie zu einem bestimmten Betriebspunkt an. Ein Beispiel: Bei einer Wärmepumpe mit 12 kWh Leistung, die 3 kWh Strom einsetzt und 9 kWh Umweltwärme gewinnt, beträgt der COP-Wert 4.
Bei Sole-Wasser-Wärmepumpen sollte der COP-Wert bei B0W35 (Sole 0°C, Wasser 35°C) mindestens 4,5 betragen. Je höher der Wert, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Bei Werten unter 2 ist die Anlage nicht wirtschaftlich.
Im Gegensatz dazu beschreibt die JAZ die tatsächliche Effizienz des gesamten Heizsystems über ein volles Jahr unter realen Bedingungen. Moderne Sole-Wasser-Wärmepumpen erreichen eine JAZ von über 4, während Luft-Wasser-Wärmepumpen typischerweise eine JAZ von über 3 erreichen.
Ein wichtiger Unterschied: Die JAZ wird erst nach Installation unter tatsächlichen Nutzungsbedingungen ermittelt, während der COP ein Laborwert ist. Daher eignet sich der COP besonders gut, um verschiedene Modelle gleicher Bauart direkt zu vergleichen.
Schallwerte und Betriebsgeräusche berücksichtigen
Obwohl Sole-Wasser-Wärmepumpen deutlich leiser als Luft-Wasser-Modelle arbeiten, sollten Sie die Geräuschemissionen nicht vernachlässigen. Im Vergleich zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 50-65 Dezibel sind die Betriebsgeräusche einer Sole-Wasser-Wärmepumpe allerdings vernachlässigbar.
Dennoch empfehle ich folgende Massnahmen zur Schallreduzierung bei Innenaufstellung:
- Schallschluckender Untergrund wie ein Betonsockel mit Gummimatte
- Vermeidung leerer Räume (verstärken den Schall)
- Entkopplung der Rohrleitungen
- Bei Bedarf Schallschutztüren einplanen
In der Schweiz gelten zudem strenge Grenzwerte: In Wohngebieten dürfen tagsüber maximal 55 Dezibel und nachts höchstens 45 Dezibel erreicht werden.
Zuverlässigkeit und Garantieleistungen vergleichen
Für die langfristige Zufriedenheit mit Ihrer Sole-Wasser-Wärmepumpe sind Qualität und Garantieleistungen ausschlaggebend. Dabei lohnt sich der Blick auf:
- Herstellergarantien: Achten Sie auf mindestens 5 Jahre Garantie auf alle Hauptkomponenten
- Verfügbarkeit des Kundendienstes in Ihrer Region
- Verwendete Materialien und Bauweise
- Referenzprojekte des Herstellers
Die Lebensdauer einer hochwertigen Sole-Wasser-Wärmepumpe liegt bei etwa 20 Jahren, wobei die Erdsonden sogar 50 Jahre oder länger halten können. Dadurch sinken die Kosten im zweiten Lebenszyklus erheblich, da keine neuen Bohrungen erforderlich sind.
Zusätzlich sollten Sie auf die Kompatibilität mit anderen Systemen achten. Moderne Wärmepumpen bieten oft Smart-Home-Funktionen und die Möglichkeit zur Einbindung von Photovoltaik, was die Wirtschaftlichkeit weiter verbessern kann.
Bei einem Vergleich zwischen verschiedenen Wärmepumpentypen schneidet die Sole-Wasser-Wärmepumpe besonders gut ab: Sie erreicht COP-Werte von 4,5-5,0 und eine JAZ von über 4, während Wasser-Wasser-Wärmepumpen mit COP-Werten von 5,0-6,0 und einer JAZ von über 5 noch effizienter sind.
Der Installationsprozess: Von der Planung bis zur Inbetriebnahme
Der Wechsel zu einer Sole-Wasser-Wärmepumpe erfordert einen durchdachten Installationsprozess. Von der ersten Planung bis zur endgültigen Inbetriebnahme durchläuft die Installation mehrere Phasen, die sorgfältige Koordination und Fachwissen benötigen.
Zeitplan erstellen: Dauer der einzelnen Schritte
Die reine Installation einer Sole-Wasser-Wärmepumpe nimmt etwa zwei bis drei Tage in Anspruch. Falls zuvor ein bestehendes Heizsystem entfernt werden muss, kann sich die Gesamtdauer auf bis zu sieben Tage verlängern. Bei der Zeitplanung sollten folgende Arbeitsschritte berücksichtigt werden:
- Bohrarbeiten für Erdsonden: Je nach Tiefe und Anzahl der benötigten Sonden
- Verlegung der Sole-Leitungen zum Technikraum
- Installation der Wärmepumpe und des Pufferspeichers
- Anschluss an das bestehende Heizsystem
- Elektroanschlüsse und Installation des Zählers
Möchten Sie im Winter auf eine Wärmepumpe wechseln, empfiehlt es sich, das Fundament bereits vor dem ersten Frost anlegen zu lassen. Die Arbeitsschritte verlaufen teilweise parallel, weshalb eine gute Koordination zwischen den verschiedenen Fachleuten unerlässlich ist.
Die richtige Fachfirma finden
Die Qualität der Installation beeinflusst massgeblich die Effizienz und Lebensdauer Ihrer Wärmepumpenanlage. Daher ist die Auswahl des richtigen Fachbetriebs entscheidend. Achten Sie auf:
- Erfahrung mit Sole-Wasser-Wärmepumpen und entsprechende Referenzen
- Kenntnis der lokalen Bodenbeschaffenheit und länderspezifischer Vorgaben
- Qualifikation für kältetechnische Arbeiten gemäss EU-Verordnung
- Expertise in der richtigen Dimensionierung von Heizanlagen, Warmwasser- und Pufferspeichern
Ein kompetenter Fachbetrieb übernimmt zudem die Beantragung der erforderlichen Genehmigungen, da bei Erdsonden-Bohrungen bis zu 100 Metern mehrere grundwasserführende Schichten durchbrochen werden können.
Qualitätskontrolle während und nach der Installation
Nach Abschluss der Installation sind mehrere Qualitätsprüfungen erforderlich. Bei Wärmepumpen in Splitausführung muss die kältetechnische Verrohrung einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden. Zudem sollten folgende Aspekte kontrolliert werden:
- Korrekte Einbindung des Wärmeerzeugers ins Heizungssystem
- Optimale Einstellung der Heizkurve (erhebliches Energiesparpotential)
- Funktionalität bei Zusammenspiel mit Photovoltaikanlagen
- Hydraulischer Abgleich zur gleichmässigen Wärmeverteilung in allen Heizungsleitungen
Eine regelmässige professionelle Kontrolle des Heizsystems nach der Installation ist empfehlenswert, um Effizienzverluste dauerhaft zu vermeiden. Dazu gehört auch die jährliche Wartung, bei der unter anderem die Soleflüssigkeit und ihre Konzentration überprüft werden. Bei modernen Anlagen besteht zudem die Möglichkeit der Fernüberwachung durch den Installationsbetrieb.
Schlussfolgerung
Zusammenfassend bietet eine Sole-Wasser-Wärmepumpe beachtliche Vorteile für Hausbesitzer. Die Ersparnis von etwa 40’000 Franken über 20 Jahre verglichen mit einer Ölheizung rechtfertigt die anfängliche Investition. Besonders die hohe Jahresarbeitszahl von 4 unterstreicht die aussergewöhnliche Effizienz dieser Technologie.
Grundsätzlich hängt der Erfolg einer Sole-Wasser-Wärmepumpe von drei wesentlichen Faktoren ab: Der sorgfältigen Analyse des Grundstücks, der präzisen Dimensionierung der Anlage und der fachgerechten Installation durch qualifizierte Fachbetriebe. Die Wahl zwischen Erdsonden, Flächenkollektoren oder Erdwärmekörben sollte dabei auf Basis der individuellen Gegebenheiten getroffen werden.
Letztendlich macht die Kombination aus kantonalen Förderprogrammen, steuerlichen Vorteilen und niedrigen Betriebskosten die Sole-Wasser-Wärmepumpe zu einer zukunftssicheren Investition. Die lange Lebensdauer der Erdsonden von über 50 Jahren gewährleistet dabei eine nachhaltige Nutzung der Erdwärme über mehrere Generationen hinweg.
Zweifellos stellt die Umstellung auf eine Sole-Wasser-Wärmepumpe einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiges Heizen dar. Mit diesem umfassenden Praxis-Guide können Sie eine fundierte Entscheidung für Ihr Heizsystem treffen und von den langfristigen Vorteilen dieser effizienten Technologie profitieren.